Für einen Fernsehtipp ist es wohl etwas spät, was? 23 Uhr ARD, Dominik Grafs toller "Hotte im Paradies", allerdings auch um 0:20 Uhr auf Arte. Vielleicht gibt's ja sogar noch eine Wiederholung. Bin zu faul zum Nachsehen.
Svenson - am Donnerstag, 16. September 2004, 22:50 - Rubrik: things i never told you
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Kleiner Zufall. Auf der Leinwand - "The Village" - ist ein kleiner Koffer/Kasten zu sehen. Fast quadratisch in der Grundfläche und recht hoch. Mit Lederriemen. Herr Hose flüstert: "Wie in ‚Kiss Me, Deadly'". Ich flüstere zurück: "Habe ich gestern gesehen". Dazu muss man (vielleicht auch nicht) wissen, dass uns eine kurzlebige gemeinsame Mitgliedschaft in einem ebenso kurzlebigen Filmclub eint, von dessen wenigen Diskussionsgegenständen "Rattennest" also "Kiss Me, Deadly" einer war. (Neben u.a. "Die 120 Tage von Sodom" und "Total Recall"). Die anderen fanden den Film einst mittelmäßig bis schlecht, mir gefiel er außerordentlich. Das hat sich nun ganz und gar nicht geändert. Im Gegenteil. Der Film hat sich bis heute eine rüde Direktheit bewahrt, die ihresgleichen sucht. Und das liegt vor allem an seinem Erzählmodus weniger an seinem Inhalt, der sicher mal noch erheblich brisanter erschien als heute.
Es fängt mit einer verängstigten Frau an, was schon mal grundsätzlich ein klasse Filmstart ist. Diese Frau befindet sich auf einer nächtlichen Landstraße, bekleidet mit (nix als?) einem kurzen Mantel, und versucht, ein Auto anzuhalten, aber kein Fahrer reagiert. Also stellt sie sich mitten auf die Straße, ein offener Sportwagen (Kenner wollen jetzt die Marke, Baujahr etc., aber ich kenn mich halt nicht aus) bremst hart und kommt seitlich von der Straße ab. In diesem Auto sitzt Mike Hammer, der keinen Hehl daraus macht, dass er nur für einen Daumen nicht angehalten hätte, der die Frau aber gleichwohl mitnimmt. Nun rollen die Titel von oben nach unten über die Autofahrt, also verkehrt herum. Das irritiert. Noch mehr irritiert, dass dieser Vorspann neben Fahrgeräuschen lediglich mit dem Schluchzen der Frau unterlegt ist, das irgendwann fast wie ein irres Lachen klingt. Dann Gespräch der beiden, die Handlung wird vorbereitet, er hilft ihr bei einer Straßensperre widerwillig. Er soll sie an einer Bushaltestelle absetzen, von da käme sie alleine weiter. Für den Fall allerdings, dass sie es nicht bis zur Haltestelle schaffen sollten, sagt sie ihm:"Remember Me!" Wieso sollten sie es nicht schaffen, fragt er, sie seien doch gleich da, als der Wahnsinn auch schon los geht. Nun besteht die Gefahr, den ganzen Film nachzuerzählen. Die ist aber hiermit gebannt. "Kiss Me, Deadly", der seinen von dem eigentlich fast milchbubihaft weich aussehenden Ralph Meeker gespielten Helden Mike Hammer diverse Küsse mit bemerkenswerter Gleichgültigkeit hinter sich bringen lässt, zeigt eine fürchterliche Welt. Töten und sein Gegenstück Sterben lassen hier jede Eleganz vermissen. Sie sind auch mehr als funktionale Erzählelemente. Sterben tut weh, sieht eklig aus, dauert lange. Mehr als einmal musste ich an "Torn Curtain" denken. Es gibt keine geschliffenen Wortgefechte zwischen Detektiv und Bösewicht. Die Gemeinheit ist direkt und überall, auch ein bisschen in Mike Hammer. (Man bedenke: Wäre er ein noch unsympathischerer und vor allem gleichgültigerer Typ gewesen, als er so schon ist, hätte er also die Frau gar nicht mitgenommen, er hätte weiterhin ohne große Reibung in diese verkommene Welt gepasst). Alle schnauzen sich, wo es geht, gegenseitig an und die gutmütigen oder gut gelaunten Figuren überleben selten. Das furiose Finale - inhaltlich etwas gealtert, von der Darstellung her allerdings gewaltig - hat mindestens Tarantino und Lynch inspiriert (der Koffer aus dem es strahlt/Pulp Fiction und die brennende Hütte/Lost Highway).
Und gibt es eine psychologische Erklärung dafür, dass es mich so berührt hat, erst einen Mann eine lange Treppe von der Kamera weg hinunter laufen und im Gegenschuss eine Frau die gleiche Treppe herunter kommen zu sehen?
Es fängt mit einer verängstigten Frau an, was schon mal grundsätzlich ein klasse Filmstart ist. Diese Frau befindet sich auf einer nächtlichen Landstraße, bekleidet mit (nix als?) einem kurzen Mantel, und versucht, ein Auto anzuhalten, aber kein Fahrer reagiert. Also stellt sie sich mitten auf die Straße, ein offener Sportwagen (Kenner wollen jetzt die Marke, Baujahr etc., aber ich kenn mich halt nicht aus) bremst hart und kommt seitlich von der Straße ab. In diesem Auto sitzt Mike Hammer, der keinen Hehl daraus macht, dass er nur für einen Daumen nicht angehalten hätte, der die Frau aber gleichwohl mitnimmt. Nun rollen die Titel von oben nach unten über die Autofahrt, also verkehrt herum. Das irritiert. Noch mehr irritiert, dass dieser Vorspann neben Fahrgeräuschen lediglich mit dem Schluchzen der Frau unterlegt ist, das irgendwann fast wie ein irres Lachen klingt. Dann Gespräch der beiden, die Handlung wird vorbereitet, er hilft ihr bei einer Straßensperre widerwillig. Er soll sie an einer Bushaltestelle absetzen, von da käme sie alleine weiter. Für den Fall allerdings, dass sie es nicht bis zur Haltestelle schaffen sollten, sagt sie ihm:"Remember Me!" Wieso sollten sie es nicht schaffen, fragt er, sie seien doch gleich da, als der Wahnsinn auch schon los geht. Nun besteht die Gefahr, den ganzen Film nachzuerzählen. Die ist aber hiermit gebannt. "Kiss Me, Deadly", der seinen von dem eigentlich fast milchbubihaft weich aussehenden Ralph Meeker gespielten Helden Mike Hammer diverse Küsse mit bemerkenswerter Gleichgültigkeit hinter sich bringen lässt, zeigt eine fürchterliche Welt. Töten und sein Gegenstück Sterben lassen hier jede Eleganz vermissen. Sie sind auch mehr als funktionale Erzählelemente. Sterben tut weh, sieht eklig aus, dauert lange. Mehr als einmal musste ich an "Torn Curtain" denken. Es gibt keine geschliffenen Wortgefechte zwischen Detektiv und Bösewicht. Die Gemeinheit ist direkt und überall, auch ein bisschen in Mike Hammer. (Man bedenke: Wäre er ein noch unsympathischerer und vor allem gleichgültigerer Typ gewesen, als er so schon ist, hätte er also die Frau gar nicht mitgenommen, er hätte weiterhin ohne große Reibung in diese verkommene Welt gepasst). Alle schnauzen sich, wo es geht, gegenseitig an und die gutmütigen oder gut gelaunten Figuren überleben selten. Das furiose Finale - inhaltlich etwas gealtert, von der Darstellung her allerdings gewaltig - hat mindestens Tarantino und Lynch inspiriert (der Koffer aus dem es strahlt/Pulp Fiction und die brennende Hütte/Lost Highway).
Und gibt es eine psychologische Erklärung dafür, dass es mich so berührt hat, erst einen Mann eine lange Treppe von der Kamera weg hinunter laufen und im Gegenschuss eine Frau die gleiche Treppe herunter kommen zu sehen?
Svenson - am Donnerstag, 16. September 2004, 22:49 - Rubrik: It's only DVD but I like it
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Das war also "The Village". Ich hab's geahnt. Es ist nicht immer von Vorteil, Kritiken zu lesen. Vielleicht hätte es geholfen, sich die Mühe zu machen, nachzuschauen, was jeweils die gleichen Autoren damals über "Signs" geschrieben haben. Hätten sie damals auch nicht von nervenzerrender Zähigkeit berichtet, oder vergleichbares durch die Blume gesagt, ich hätte gewusst: dieses erneute Lob wird meine Zustimmung erneut nicht gewinnen. Mein Sitznachbar, Herr Hose, sprach von Menschen, die "The Village" für den gruseligsten Film hielten, den sie je gesehen hatten. Selbst erfahren im undifferenzierten Umsichwerfen mit Superlativen war mir natürlich klar, dass man das etwas kühler essen muss, aber eiskalt? Gruselig war's nämlich nicht bzw. sehr selten. Spannend: auch Fehlanzeige.
Also: Da wohnen Menschen in einem Dorf, das von Wald umgeben ist. Irgendwo dahinter ist "die Stadt". Es gibt Dorfbewohner, die mal da waren. Damals. Jetzt geht keiner mehr in den Wald, denn da sind "die Unaussprechlichen", rotgewandete igelartige Wurzelmonster, mit denen es einen Waffenstillstand gibt. Wir gehen nicht in den Wald, ihr kommt nicht ins Dorf. Man darf nicht in den Wald. Die Ältestenversammlung stellt noch einmal fest: Man darf nicht in den Wald. Ein Geisteskranker geht in den Wald, aber nur vornean. Das durfte er nicht. Auch die Kinder dürfen nicht in den Wald. Ebenso nicht die jungen Männer. Thema der ersten Stunde: Wald und hineingehen schließt sich aus. Das ist unfair beschrieben. Natürlich gibt es noch mehr: Die archaisch anmutende Dorfgemeinschaft mit ihrem steifen floskelhaften Rededuktus. Da wird offenbar außer Sex noch einiges mehr verdrängt, denn, wie es schon die "Unaussprechlichen vermuten lassen, gibt es Redetabus. Von Ferne grüßen die Amisch herüber. Des weiteren: Die dräuende Musik. Die dem Horrorfilm abgeguckte spannungssteigernde Methode, Figuren isoliert im Bild zu zeigen, so dass jederzeit das Monster überraschend ins Bild platzen kann. Oder ist es andersrum? Dies ist ein Horrorfilm, der sich um jeden Preis veredeln möchte mit Be- und Andeutung? Es ist mir eigentlich völlig egal, denn dieser Mix streitet mit "Catwoman" um den langweiligsten Film des Jahres. Mist. Superlativ.
Wenn es gegen Ende doch noch mal interessant wird, dann macht das nur den ersten Teil des Films noch deprimierender. Hier kann man, ohne was zu verraten, allerdings nicht ernsthaft drauf einsteigen, also vielleicht später.
Um Einwänden zuvorzukommen: Schauspieler ok, Bryce Dallas Howard sehr gut, Kamera, soll heißen Licht und Farbe: schon nicht schlecht. Die Technik, eine Farbe völlig aus der Palette zu entfernen, hat Roger Deakins ja schon in "O Brother, Where Art Thou?" kompetent eingesetzt. Hier fehlt Rot.
Übrigens ... wie kann ein Dorf mitten im Wald autark sein?
(Hab' ich am Ende die Erklärung verschlafen? Habe ich geschlafen? Herr Hose?)
Also: Da wohnen Menschen in einem Dorf, das von Wald umgeben ist. Irgendwo dahinter ist "die Stadt". Es gibt Dorfbewohner, die mal da waren. Damals. Jetzt geht keiner mehr in den Wald, denn da sind "die Unaussprechlichen", rotgewandete igelartige Wurzelmonster, mit denen es einen Waffenstillstand gibt. Wir gehen nicht in den Wald, ihr kommt nicht ins Dorf. Man darf nicht in den Wald. Die Ältestenversammlung stellt noch einmal fest: Man darf nicht in den Wald. Ein Geisteskranker geht in den Wald, aber nur vornean. Das durfte er nicht. Auch die Kinder dürfen nicht in den Wald. Ebenso nicht die jungen Männer. Thema der ersten Stunde: Wald und hineingehen schließt sich aus. Das ist unfair beschrieben. Natürlich gibt es noch mehr: Die archaisch anmutende Dorfgemeinschaft mit ihrem steifen floskelhaften Rededuktus. Da wird offenbar außer Sex noch einiges mehr verdrängt, denn, wie es schon die "Unaussprechlichen vermuten lassen, gibt es Redetabus. Von Ferne grüßen die Amisch herüber. Des weiteren: Die dräuende Musik. Die dem Horrorfilm abgeguckte spannungssteigernde Methode, Figuren isoliert im Bild zu zeigen, so dass jederzeit das Monster überraschend ins Bild platzen kann. Oder ist es andersrum? Dies ist ein Horrorfilm, der sich um jeden Preis veredeln möchte mit Be- und Andeutung? Es ist mir eigentlich völlig egal, denn dieser Mix streitet mit "Catwoman" um den langweiligsten Film des Jahres. Mist. Superlativ.
Wenn es gegen Ende doch noch mal interessant wird, dann macht das nur den ersten Teil des Films noch deprimierender. Hier kann man, ohne was zu verraten, allerdings nicht ernsthaft drauf einsteigen, also vielleicht später.
Um Einwänden zuvorzukommen: Schauspieler ok, Bryce Dallas Howard sehr gut, Kamera, soll heißen Licht und Farbe: schon nicht schlecht. Die Technik, eine Farbe völlig aus der Palette zu entfernen, hat Roger Deakins ja schon in "O Brother, Where Art Thou?" kompetent eingesetzt. Hier fehlt Rot.
Übrigens ... wie kann ein Dorf mitten im Wald autark sein?
(Hab' ich am Ende die Erklärung verschlafen? Habe ich geschlafen? Herr Hose?)
Svenson - am Donnerstag, 16. September 2004, 21:46 - Rubrik: blockbusters!
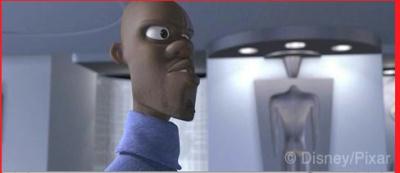
bähr - am Donnerstag, 16. September 2004, 19:34 - Rubrik: blockbusters!
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Nach den ersten vier Folgen von „24“, erste Staffel, freue ich mich auf die zweiten vier Folgen, die schon hechelnd an meinem Bein hoch springen. Ich tätschele sie und vertröste sie auf den Abend, schließlich gibt es Arbeit zu tun.
Was wäre eigentlich, wenn James T. Kirk einen Anruf von Starfleet Command kriegen würde (verschlüsselt, na klar), in dem ihm mitgeteilt wird, dass eine Verschwörung läuft (um den Chef der Föderation zu ermorden), und jemand aus seiner Truppe dahintersteckt?

Ja, dann hätte man ungefähr das, was 24 zeigt: Irgendwie erinnert Kiefer Sutherland in seiner ihm fremd gewordenen Kommandozentrale sehr an einen Kirk, der vermutet, das Chekov ein Spion der Klingonen ist, und nur noch Spock und Uhura vertrauen kann und mit ihnen tuschelt. Und der seinen Transmitter nicht mehr benutzen mag (oder wie hießen die Dinger). Über den also, nach einer Periode fröhlichen imperialen Sammelns, das Zeitalter des Terrorismus hereingebrochen ist.
Und auch ansonsten sind sie sich irgendwie ähnlich: Bauer (Sutherland) zwar der etwas radikalere Charakter, aber ansonsten beide immer aufgelegt, für das unbestechlich empfundene Staatstragende / Föderationsnützliche die Befehle der höheren Kommandoebene zu missachten und Schimanskimäßig auf Warp zu gehen.
Die Dramaturgie von 24 – bis zu diesem Punkt – ist eine des stetigen Verhinderns. Scharfe Konflikte werden aufgebaut, jemand (meist Kiefer) macht sich auf, die zu lösen, kommt aber gar nicht in die Nähe seines Ziels, weil er schon wieder unterbrochen, in eine andere Handlungsschleife gezerrt wird, um dort wieder unterbrochen zu werden. Und das – so jedenfalls mein Eindruck bis hier – ist eines der Mittel, aus denen die bezwingende Atemlosigkeit der Serie sich speist.
Sehr spannend, so far.
Und die Geschichte mit dem gequälten Mädchen – da mochte ich mal wieder am liebsten vorspulen. War aber tapfer.
Was wäre eigentlich, wenn James T. Kirk einen Anruf von Starfleet Command kriegen würde (verschlüsselt, na klar), in dem ihm mitgeteilt wird, dass eine Verschwörung läuft (um den Chef der Föderation zu ermorden), und jemand aus seiner Truppe dahintersteckt?

Ja, dann hätte man ungefähr das, was 24 zeigt: Irgendwie erinnert Kiefer Sutherland in seiner ihm fremd gewordenen Kommandozentrale sehr an einen Kirk, der vermutet, das Chekov ein Spion der Klingonen ist, und nur noch Spock und Uhura vertrauen kann und mit ihnen tuschelt. Und der seinen Transmitter nicht mehr benutzen mag (oder wie hießen die Dinger). Über den also, nach einer Periode fröhlichen imperialen Sammelns, das Zeitalter des Terrorismus hereingebrochen ist.
Und auch ansonsten sind sie sich irgendwie ähnlich: Bauer (Sutherland) zwar der etwas radikalere Charakter, aber ansonsten beide immer aufgelegt, für das unbestechlich empfundene Staatstragende / Föderationsnützliche die Befehle der höheren Kommandoebene zu missachten und Schimanskimäßig auf Warp zu gehen.
Die Dramaturgie von 24 – bis zu diesem Punkt – ist eine des stetigen Verhinderns. Scharfe Konflikte werden aufgebaut, jemand (meist Kiefer) macht sich auf, die zu lösen, kommt aber gar nicht in die Nähe seines Ziels, weil er schon wieder unterbrochen, in eine andere Handlungsschleife gezerrt wird, um dort wieder unterbrochen zu werden. Und das – so jedenfalls mein Eindruck bis hier – ist eines der Mittel, aus denen die bezwingende Atemlosigkeit der Serie sich speist.
Sehr spannend, so far.
Und die Geschichte mit dem gequälten Mädchen – da mochte ich mal wieder am liebsten vorspulen. War aber tapfer.
bähr - am Donnerstag, 16. September 2004, 10:20 - Rubrik: Seasons in the Sun
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Wenn ich einen Film noch nicht gesehen habe, aber schon mehr als die Hälfte der Zeit, die dieser Film dauert, damit verbracht habe, etwas über ihn zu lesen, und ihn mir dann nicht anschaue, fühle ich mich zwei Wochen später irgendwie leer. Erkenne ihn aber beim ersten Hinschauen, wenn er Jahre später im Fernsehen läuft.
Also werde ich mir "Der Untergang" und "The Village" wohl anschauen.
Also werde ich mir "Der Untergang" und "The Village" wohl anschauen.
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Wenn das stimmt, dann ist es eine Katastrophe.
Und ein Grund, warum man vielleicht gar keine große Kunst machen sollte: Man lädt sich zuviel Verantwortung auf die Schultern.
Katja Nicodemus verreißt in der Zeit die „Heimat 3“. Vehement. Enttäuschend sei sie. Peinlich. „Dallas“ wird erwähnt, „Die Guldenburgs“. Keine „politische Überformung des Privaten“ mehr, sondern „Mythisierung des Trivialen“. Zu nah an Herrmännsche und Clarissa, zu viele Soap-Geschichten wie Krebs, Selbstmord, etc.
Eine Katastrophe, wenn das stimmt, und leider ist dem Urteil von Frau Nicodemus eigentlich zu trauen. Und ihre Unterstellung, die Neunziger seien eine Zeit, mit der Reitz einfach nichts mehr zu tun habe und dass daher in seinem Film nur vergangenes Lebensgefühl, nicht mehr das der handlungsrelevanten Jahrzehnte gezeigt werde, sehr nahe liegend.
Und: Der Osten nur als Kulisse, als Fußnote, als Pappkamerad in der eigentlich westdeutschen Erzählwelt des Films – was hat denn Thomas Brussig gemacht?
Das kann ja wohl nicht stimmen. Ich bin ernsthaft besorgt.
Zuviel - oder das Falsche – verlangt Frau Nicodemus wohl, wenn sie das Fehlen von Techno und Loveparade bemängelt. Reitz bleibt ja bei seinen alten Figuren, die eben in den 50ern Jung waren, nicht in den Neunzigern. Da kennt er sich aus, und wir thirtysomethings können von dem Mann wohl nicht verlangen, das er jetzt unsere Jugend nacherzählt.
Das müssen wir selber. (->erzählen lernen)
Aber trotzdem. Gerade die „Zweite Heimat“ bedeutete so viel, war ein neues Wort, einer der großen Einzelfälle in Deutschland, wo das Fernsehgenre „Serie“ zu einer eigenen, guten und natürlichen Form gefunden hatte, wie danach möglicherweise nicht mehr.
Während die Serie als Genre in den USA eine atemberaubende Renaissance erlebte, schien der deutsche Fernsehbetrieb nicht in der Lage, die Spur aufzunehmen – nicht zuletzt sicher, weil die „Zweite Heimat“ den Quotenerfolg der ersten nicht wiederholte.
Für mich, und darum ist sie mir besonders teuer, verbindet sich mit der Serie eines der eindringlichsten Kinoerlebnisse. Es war in Moskau, die Sommerabende waren lang, und das „Dom Kino“, eine Art überdimensioniertes kommunales Kino, zeigte die „Zweite Heimat“ an aufeinanderfolgenden Tagen. Nicht vorher und nicht nachher habe ich mich so dem Deutschen (so im Großen und Ganzen) zugehörig empfunden, wie in den Momenten, in denen ich den Saal verlies und durch die Fenster des Foyers hinaus auf die Dächer und Kuppeln Moskaus schaute. Den Titel, so meine ich, hatte die Serie zu recht. So deutsch die Verhakelungen der Liebe, die Schwärmerei, die Arroganz, die Ambitionen. So bekannt das, wohin man will, und das, wohin es einen führt, und warum es einen dahin führt. Ein fesselndes Mentalitätsbild, das, obwohl in München (wo ich kaum war) und vor meiner Geburt angesiedelt, treffender kaum sein konnte. Und dessen Unterschiedenheit von Anderem umso deutlicher wurde, weil ich ja die Menschen um mich kannte, diese Russen, die in vielem so ähnlich und insgesamt so bezaubernd, aber in vielem auch so völlig unbegreifbar und fremd waren: In ihrem todernsten Pathos, ihrem Klassendünkel (und das nach 70 Jahren Sozialismus!) (oder deswegen!), ihrer Offenheit, ihrem Machismo, ihrer fast gefährlichen Freundschaft.
Da hat mir also das Zusammenwirken dieses so genauen und so emotionalen Filmes und dieser beeindruckenden Stadt ein Gefühl geschenkt, dessen Gegenteil ich damals in Deutschland stets kultiviert hatte (gezwungen, allerdings, durch Helmut Kohl und seine Kohorten – zu denen wollte man nun wirklich nicht gehören): Zugehörigkeit. Wenn das in Deutschland so ist, wenn die Menschen dort so fühlen und handeln, gehöre ich wohl dazu.
Ja, und nun macht Reitz also was über die Wende, die Neunziger, natürlich, da habe ich so einiges erwartet, und auch gedacht: Der Mann hat 24 gelungene Teile rausgedrückt, da scheint er es ja zu können, da ist die Frage gar nicht so sehr, OB es klappt, sondern WIE es klappt...
Und nun, gierig von mir gelesen, die erste Kritik nach der Premiere in Venedig, ein Verriss. Ein totaler. Oh nein, wirklich, das wäre eine Katastrophe.
Nur die Ruhe, sag ich mir.
Und ein Grund, warum man vielleicht gar keine große Kunst machen sollte: Man lädt sich zuviel Verantwortung auf die Schultern.
Katja Nicodemus verreißt in der Zeit die „Heimat 3“. Vehement. Enttäuschend sei sie. Peinlich. „Dallas“ wird erwähnt, „Die Guldenburgs“. Keine „politische Überformung des Privaten“ mehr, sondern „Mythisierung des Trivialen“. Zu nah an Herrmännsche und Clarissa, zu viele Soap-Geschichten wie Krebs, Selbstmord, etc.
Eine Katastrophe, wenn das stimmt, und leider ist dem Urteil von Frau Nicodemus eigentlich zu trauen. Und ihre Unterstellung, die Neunziger seien eine Zeit, mit der Reitz einfach nichts mehr zu tun habe und dass daher in seinem Film nur vergangenes Lebensgefühl, nicht mehr das der handlungsrelevanten Jahrzehnte gezeigt werde, sehr nahe liegend.
Und: Der Osten nur als Kulisse, als Fußnote, als Pappkamerad in der eigentlich westdeutschen Erzählwelt des Films – was hat denn Thomas Brussig gemacht?
Das kann ja wohl nicht stimmen. Ich bin ernsthaft besorgt.
Zuviel - oder das Falsche – verlangt Frau Nicodemus wohl, wenn sie das Fehlen von Techno und Loveparade bemängelt. Reitz bleibt ja bei seinen alten Figuren, die eben in den 50ern Jung waren, nicht in den Neunzigern. Da kennt er sich aus, und wir thirtysomethings können von dem Mann wohl nicht verlangen, das er jetzt unsere Jugend nacherzählt.
Das müssen wir selber. (->erzählen lernen)
Aber trotzdem. Gerade die „Zweite Heimat“ bedeutete so viel, war ein neues Wort, einer der großen Einzelfälle in Deutschland, wo das Fernsehgenre „Serie“ zu einer eigenen, guten und natürlichen Form gefunden hatte, wie danach möglicherweise nicht mehr.
Während die Serie als Genre in den USA eine atemberaubende Renaissance erlebte, schien der deutsche Fernsehbetrieb nicht in der Lage, die Spur aufzunehmen – nicht zuletzt sicher, weil die „Zweite Heimat“ den Quotenerfolg der ersten nicht wiederholte.
Für mich, und darum ist sie mir besonders teuer, verbindet sich mit der Serie eines der eindringlichsten Kinoerlebnisse. Es war in Moskau, die Sommerabende waren lang, und das „Dom Kino“, eine Art überdimensioniertes kommunales Kino, zeigte die „Zweite Heimat“ an aufeinanderfolgenden Tagen. Nicht vorher und nicht nachher habe ich mich so dem Deutschen (so im Großen und Ganzen) zugehörig empfunden, wie in den Momenten, in denen ich den Saal verlies und durch die Fenster des Foyers hinaus auf die Dächer und Kuppeln Moskaus schaute. Den Titel, so meine ich, hatte die Serie zu recht. So deutsch die Verhakelungen der Liebe, die Schwärmerei, die Arroganz, die Ambitionen. So bekannt das, wohin man will, und das, wohin es einen führt, und warum es einen dahin führt. Ein fesselndes Mentalitätsbild, das, obwohl in München (wo ich kaum war) und vor meiner Geburt angesiedelt, treffender kaum sein konnte. Und dessen Unterschiedenheit von Anderem umso deutlicher wurde, weil ich ja die Menschen um mich kannte, diese Russen, die in vielem so ähnlich und insgesamt so bezaubernd, aber in vielem auch so völlig unbegreifbar und fremd waren: In ihrem todernsten Pathos, ihrem Klassendünkel (und das nach 70 Jahren Sozialismus!) (oder deswegen!), ihrer Offenheit, ihrem Machismo, ihrer fast gefährlichen Freundschaft.
Da hat mir also das Zusammenwirken dieses so genauen und so emotionalen Filmes und dieser beeindruckenden Stadt ein Gefühl geschenkt, dessen Gegenteil ich damals in Deutschland stets kultiviert hatte (gezwungen, allerdings, durch Helmut Kohl und seine Kohorten – zu denen wollte man nun wirklich nicht gehören): Zugehörigkeit. Wenn das in Deutschland so ist, wenn die Menschen dort so fühlen und handeln, gehöre ich wohl dazu.
Ja, und nun macht Reitz also was über die Wende, die Neunziger, natürlich, da habe ich so einiges erwartet, und auch gedacht: Der Mann hat 24 gelungene Teile rausgedrückt, da scheint er es ja zu können, da ist die Frage gar nicht so sehr, OB es klappt, sondern WIE es klappt...
Und nun, gierig von mir gelesen, die erste Kritik nach der Premiere in Venedig, ein Verriss. Ein totaler. Oh nein, wirklich, das wäre eine Katastrophe.
Nur die Ruhe, sag ich mir.
bähr - am Montag, 13. September 2004, 21:44 - Rubrik: vorher - nachher
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Gerade folgende kaum zu überschätzende Leihgabe bekommen: Monty Python's Flying Circus komplett auf DVD (Scott of the Sahara, Scott of the Sahara, Scott of the Sahara). Das gibt's ja gar nicht. Wie soll das den weitergehen, wenn in wenigen Tagen die zweite Staffel "The West Wing" eintrifft, die ihrerseits die bereits vorhandene dritte aktiviert und die Zeit sich nicht auf wundersame Weise vermehrt (Ausserdem womoeglich mit baehr beide Staffeln 24 gucken. Wer plant, verliert. Wahrscheinlich einfach geschehen lassen.) Und die zweite Staffel "Mad About You" schreit auch schon: "Guck mich! Guck mich!" Und wer möchte schon gerne mit Pech übergossen werden. Und das Kino verlangt auch, dass man sich ihm mit aller gebotenen Sorgfalt widmet. Old Boy, Girls Club (!), In deinen Händen, Dänische Delikatessen, The Village (ist da am Ende was dran? Ich mag's kaum glauben, "Signs" war so ein gähnend langweiliger Quatsch, aber jetzt mahnen sogar ernstzunehmende Stimmen zur Geduld), Hab ich was vergessen? "Riddick"? "Pitch Black" war ja ganz gut. Oder sogar "Sommersturm"? Der Trailer war aber abscheulich. Andererseits: Scheiß auf den Trailer. Mal sehen, ob das Wochenende vier Filme hergibt.
Svenson - am Samstag, 11. September 2004, 04:27 - Rubrik: Seasons in the Sun
Six Degrees of Separation (to Kevin Bacon) heißt das Spiel. Ich weiß wieder warum. Habe es wahrscheinlich immer gewusst. Habe mir gerade erneut (ich weiß, dass ich ein Triebtäter bin) „Bad Santa“ angeguckt und fühle mich in einer Szene stark an „Diner“ erinnert. Ebenfalls ein großartiger Film – einer meiner liebsten, das Popcorn! – , wenn auch etwas anders gelagert. Jedenfalls: in beiden Filmen wird ein Krippenarrangemant von einer unzufriedenen alkoholisierten Person stark und nachhaltig beschädigt. Ich dachte beim erneuten Sehen und beim Heranreifen der schlauen Erkenntnis: das sind ja nur zwei Schritte. Billy Bob Thornton ist in „Bad Santa“ der Stachel im Fleisch des harmonischen Arrangemants. Er spielt aber auch in Barry Levinsons „Bandits“ mit, in dem Cate Blanchett eine sensationelle, die rhythmische Zubereitung von Speisen verherrlichende Mitsing- und Tanzszene hat. Schließlich ist Barry Levinson der Regisseur von „Diner“. Und dort ruiniert – statt routiniert TV-Quizfragen zu lösen – kein anderer als Kevin Bacon die Krippe. Ihr Kritiker dieses Spiels mit KB im Mittelpunkt: Gebt es auf. KB gewinnt immer.
Svenson - am Samstag, 11. September 2004, 03:36 - Rubrik: things i never told you
Ein Woody-Allen-Film, also reden wir über Woody Allen. Ein Woody-Allen-Film, in dem erfreulicher Weise alles ist, wie man es sich wünscht. Wie in den "guten alten" Filmen: New York, aufgeregte, schnelle Gespräche über die Zumutungen des Lebens, Angst vor dem Tod, der Liebe, wunderbare Gags, Psychiater, Schreiber, hysterische Frauen, Leidenschaft, Verzweiflung, Jazz, Jogger im Central Park...
Man fühlt sich sofort wohl in diesem Film, auf den ich schon lange gewartet habe. Wie in einem alten Cordjakett. Mit Lederflicken, versteht sich.
Nur eines ist nicht wie immer: Woody Allen. Seine übliche Rolle lässt er mal wieder spielen, diesmal von Jason Biggs, lustig schon in American Pie. Er selbst spielt eine andere, eine neue Figur, die der alten sehr ähnelt, aber in wichtigen Nuancen abweicht: Ein gealterter Gagschreiber, Ironiker, aber vor allem: Kein Verwirrter, kein Suchender, sondern einer mit einem festgefügten, zu Beginn etwas hysterisch erscheinenden Weltbild. Er stellt keine Fragen, er doziert. Seine Obsession: Selbstverteidigung, Schutz vor ihn umgebenden Feinden.
Leon de Winter hat in der aktuellen Cicero ("die" Cicero? Naja) einen Text darüber geschrieben, was es bedeutet, einen Feind zu haben. Einen Feind zu haben, bedeutet, dass es jemanden gibt, der dich töten will, egal, aus welchem Grund. Und du weißt es - da draußen ist jemand, der dich hasst, der dich töten will, und du kannst daran nichts ändern, du kannst nur damit leben, dich darauf einrichten.
Das ist, schreibt er, eine Erfahrung, mit der die Juden, er ist Jude, seit Jahrtausenden leben. Sie haben einen Feind, und sie wissen, dass sie es sich nicht einbilden, denn sie haben erlebt, was es bedeutet, wenn sie in seine Hände fallen.
Diese Erfahrung, schreibt er, macht nun die ganze westliche Gesellschaft in der Auseinandersetzung mit dem islamistischen Terrorismus. Er ist da radikal. Man solle sich nichts vor machen, ob man es möchte oder nicht, wir haben Feinde, die uns töten wollen. Dem mag man folgen oder nicht, die Überlegung, der Bewusstseinsunterschied ist es, der mir hier wichtig erscheint.
Wir, hier, heute leben seit Ende des kalten Krieges in einer Welt, in der wir keinen Feind zu haben glauben. Und selbst davor, in den Achtzigern, fühlte ich mich von der Bedrohung nicht wirklich gemeint, ich dachte: Der Feind der Sowjets bin nicht ich, es sind die Rechten, die uns regieren, ich werde nur bei dem Krieg, den sie anzetteln, mitdraufgehen. Ich habe nie geglaubt, dass der Russe mir persönlich ans Leder will, im Gegenteil.
In Woody Allens "Anything else" wird genau das verhandelt: der eine, der junge, Falk, glaubt in einer Welt ohne Feinde zu leben, in einer grudsätzlich heilen Welt, in der nur er irre ist. Die, die ihm zusetzen, verteidigt er. Der andere, der alte, Dobel, sieht sich von Feinden umzingelt.
Doch seine Ängste, seine Paranoia, die überall den Holocaust an der Wand entlang huschen sieht, ist nicht die übliche Allen'sche Paranoia, die Angst vor Krebs, vor Impotenz, Versagen. Denn Dobel ist eben nicht die übliche Allen'sche Figur, sie ist ein ironischer Pragmatiker mit tiefschwarzem, aber klarem Weltbild. Grotesk und tragisch ist seine Reaktion, nicht die Analyse. Er ist tatsächlich von Gewalt und Antisemitismus umgeben, und er zieht - sehr unallenhaft - die Konsequenz, sich zu wehren, nicht die, zu leugnen.
Dobel hat erkannt, dass es Menschen gibt, die ihm ans Leder wollen, und er tut, was er kann und schlägt ihnen die Windschutzscheibe ein, wenn sie ihn demütigen. Er ist ein Mann, der die Erfahrung dessen, was passiert, wenn man nichts tut mit sich herumzutragen scheint - nicht umsonst spricht er im Film einmal über die "Juden für Hitler", die sich arrangieren wollen. Sein Reflex, in der zivilisierten Welt, im modernen New York, stets ein "Survival Kit" bei sich tragen zu wollen, stets ein Gewehr in Griffweite, verliert bei der Projektion auf den Holocaust schlagartig an Skurrilität.
Die Szene, in der ihm von zwei fetten aggressiven Germanen eine Parklücke gestohlen wird und sie ihn ungeniert mit Prügel bedrohen und verscheuchen, ist ein Schlüssel: Genau das erwartet er von ihnen, und ist nicht bereit, es als Ausnahme, die nicht zählt, durchgehen zu lassen. Er wehret den Anfängen, kehrt zurück und rächt sich an dem Wagen. Eine in ihrer Ironiefreiheit, Pointenlosigkeit untypische Szene, die die direkte, dumme Brutalität des "Feindes" vermittelt - und die Nutzlosigkeit von Falks Vorschlag, sich damit zu trösten, man habe doch den besseren Verstand und könne eine böse Satire auf den Vorfall schreiben. Dobel zieht lieber den Schraubenschlüssel.
Diese toternste Szene zeigt, dass Dobel nicht spinnt. Er ist die Stimme der Vernunft, auch sonst schätzt er ja die Situation, in der Falk lebt, durchaus richtig ein.
Man könnte nun sagen, der Film spielt in New York, und auch hier ist am 9.11. eine Bedrohung, eine Feindschaft plötzlich Realität geworden. Die Bushadministration tut ja alles, um die US-Bürger stets daran zu erinnern, dass Menschen auf der anderen Seite der Welt sie angeblich zum Feind auserkoren haben.
Der liberale Allen als Prediger des Heimatschutzes gegen die Gefahr des islamistischen Terrors? Man will es nicht glauben. Zu recht.
Bleibt man beim Film, bietet Allen eine Alternative an: Bring deine Feinde nicht um (wie der rasende Dobel es am Ende tut), sondern erkenne sie - und gehe einfach weg.
Denn natürlich sind die Feinde Falks nicht die Neonazis, die den aus der Kindergeneration der Holocaust stammenden Dobel wahnsinnig machen - die Feinde des modernen Menschen sind jene, die ihn daran hindern, sein Leben zu leben.
Doch, so kriegen wir Allen noch von George W. Bush weg. Für ihn ist der Wunsch, sich mit der Waffe in der Hand gegen den Feind zu wehren, nicht albern, nur altmodisch, überkommen.
Er schlägt vor, den "Feind" an einer anderen Stelle zu suchen: Nicht im mittleren Osten, sondern zuhause. Ihn dort zu erkennen, ist weit schmerzlicher, ihm zu begegnen, ihn zu verlassen möglicherweise weit mutiger. In den Bildern des Films gesprochen: Es braucht mehr Mumm, eine Frau zu verlassen, die man liebt, als einen Mann zu erschießen, den man hasst.
Gefreut habe ich mich über die kleine Anspielung auf Bunuel. Als Falk und Amanda das Kino verlassen sagt ein anderer Kinogänger "Ich verstehe nicht, warum sie nach dem Essen nicht einfach weggegangen sind." Sie waren im "Würgeengel", in dem sich eine ganze Abendgesellschaft in einer ähnlich stangnierenden Situation befindet wie Falk. Bloß, dass es für sie kein Entrinnen gibt, während Falk den Ausbruch schafft.
Man fühlt sich sofort wohl in diesem Film, auf den ich schon lange gewartet habe. Wie in einem alten Cordjakett. Mit Lederflicken, versteht sich.
Nur eines ist nicht wie immer: Woody Allen. Seine übliche Rolle lässt er mal wieder spielen, diesmal von Jason Biggs, lustig schon in American Pie. Er selbst spielt eine andere, eine neue Figur, die der alten sehr ähnelt, aber in wichtigen Nuancen abweicht: Ein gealterter Gagschreiber, Ironiker, aber vor allem: Kein Verwirrter, kein Suchender, sondern einer mit einem festgefügten, zu Beginn etwas hysterisch erscheinenden Weltbild. Er stellt keine Fragen, er doziert. Seine Obsession: Selbstverteidigung, Schutz vor ihn umgebenden Feinden.
Leon de Winter hat in der aktuellen Cicero ("die" Cicero? Naja) einen Text darüber geschrieben, was es bedeutet, einen Feind zu haben. Einen Feind zu haben, bedeutet, dass es jemanden gibt, der dich töten will, egal, aus welchem Grund. Und du weißt es - da draußen ist jemand, der dich hasst, der dich töten will, und du kannst daran nichts ändern, du kannst nur damit leben, dich darauf einrichten.
Das ist, schreibt er, eine Erfahrung, mit der die Juden, er ist Jude, seit Jahrtausenden leben. Sie haben einen Feind, und sie wissen, dass sie es sich nicht einbilden, denn sie haben erlebt, was es bedeutet, wenn sie in seine Hände fallen.
Diese Erfahrung, schreibt er, macht nun die ganze westliche Gesellschaft in der Auseinandersetzung mit dem islamistischen Terrorismus. Er ist da radikal. Man solle sich nichts vor machen, ob man es möchte oder nicht, wir haben Feinde, die uns töten wollen. Dem mag man folgen oder nicht, die Überlegung, der Bewusstseinsunterschied ist es, der mir hier wichtig erscheint.
Wir, hier, heute leben seit Ende des kalten Krieges in einer Welt, in der wir keinen Feind zu haben glauben. Und selbst davor, in den Achtzigern, fühlte ich mich von der Bedrohung nicht wirklich gemeint, ich dachte: Der Feind der Sowjets bin nicht ich, es sind die Rechten, die uns regieren, ich werde nur bei dem Krieg, den sie anzetteln, mitdraufgehen. Ich habe nie geglaubt, dass der Russe mir persönlich ans Leder will, im Gegenteil.
In Woody Allens "Anything else" wird genau das verhandelt: der eine, der junge, Falk, glaubt in einer Welt ohne Feinde zu leben, in einer grudsätzlich heilen Welt, in der nur er irre ist. Die, die ihm zusetzen, verteidigt er. Der andere, der alte, Dobel, sieht sich von Feinden umzingelt.
Doch seine Ängste, seine Paranoia, die überall den Holocaust an der Wand entlang huschen sieht, ist nicht die übliche Allen'sche Paranoia, die Angst vor Krebs, vor Impotenz, Versagen. Denn Dobel ist eben nicht die übliche Allen'sche Figur, sie ist ein ironischer Pragmatiker mit tiefschwarzem, aber klarem Weltbild. Grotesk und tragisch ist seine Reaktion, nicht die Analyse. Er ist tatsächlich von Gewalt und Antisemitismus umgeben, und er zieht - sehr unallenhaft - die Konsequenz, sich zu wehren, nicht die, zu leugnen.
Dobel hat erkannt, dass es Menschen gibt, die ihm ans Leder wollen, und er tut, was er kann und schlägt ihnen die Windschutzscheibe ein, wenn sie ihn demütigen. Er ist ein Mann, der die Erfahrung dessen, was passiert, wenn man nichts tut mit sich herumzutragen scheint - nicht umsonst spricht er im Film einmal über die "Juden für Hitler", die sich arrangieren wollen. Sein Reflex, in der zivilisierten Welt, im modernen New York, stets ein "Survival Kit" bei sich tragen zu wollen, stets ein Gewehr in Griffweite, verliert bei der Projektion auf den Holocaust schlagartig an Skurrilität.
Die Szene, in der ihm von zwei fetten aggressiven Germanen eine Parklücke gestohlen wird und sie ihn ungeniert mit Prügel bedrohen und verscheuchen, ist ein Schlüssel: Genau das erwartet er von ihnen, und ist nicht bereit, es als Ausnahme, die nicht zählt, durchgehen zu lassen. Er wehret den Anfängen, kehrt zurück und rächt sich an dem Wagen. Eine in ihrer Ironiefreiheit, Pointenlosigkeit untypische Szene, die die direkte, dumme Brutalität des "Feindes" vermittelt - und die Nutzlosigkeit von Falks Vorschlag, sich damit zu trösten, man habe doch den besseren Verstand und könne eine böse Satire auf den Vorfall schreiben. Dobel zieht lieber den Schraubenschlüssel.
Diese toternste Szene zeigt, dass Dobel nicht spinnt. Er ist die Stimme der Vernunft, auch sonst schätzt er ja die Situation, in der Falk lebt, durchaus richtig ein.
Man könnte nun sagen, der Film spielt in New York, und auch hier ist am 9.11. eine Bedrohung, eine Feindschaft plötzlich Realität geworden. Die Bushadministration tut ja alles, um die US-Bürger stets daran zu erinnern, dass Menschen auf der anderen Seite der Welt sie angeblich zum Feind auserkoren haben.
Der liberale Allen als Prediger des Heimatschutzes gegen die Gefahr des islamistischen Terrors? Man will es nicht glauben. Zu recht.
Bleibt man beim Film, bietet Allen eine Alternative an: Bring deine Feinde nicht um (wie der rasende Dobel es am Ende tut), sondern erkenne sie - und gehe einfach weg.
Denn natürlich sind die Feinde Falks nicht die Neonazis, die den aus der Kindergeneration der Holocaust stammenden Dobel wahnsinnig machen - die Feinde des modernen Menschen sind jene, die ihn daran hindern, sein Leben zu leben.
Doch, so kriegen wir Allen noch von George W. Bush weg. Für ihn ist der Wunsch, sich mit der Waffe in der Hand gegen den Feind zu wehren, nicht albern, nur altmodisch, überkommen.
Er schlägt vor, den "Feind" an einer anderen Stelle zu suchen: Nicht im mittleren Osten, sondern zuhause. Ihn dort zu erkennen, ist weit schmerzlicher, ihm zu begegnen, ihn zu verlassen möglicherweise weit mutiger. In den Bildern des Films gesprochen: Es braucht mehr Mumm, eine Frau zu verlassen, die man liebt, als einen Mann zu erschießen, den man hasst.
Gefreut habe ich mich über die kleine Anspielung auf Bunuel. Als Falk und Amanda das Kino verlassen sagt ein anderer Kinogänger "Ich verstehe nicht, warum sie nach dem Essen nicht einfach weggegangen sind." Sie waren im "Würgeengel", in dem sich eine ganze Abendgesellschaft in einer ähnlich stangnierenden Situation befindet wie Falk. Bloß, dass es für sie kein Entrinnen gibt, während Falk den Ausbruch schafft.
bähr - am Freitag, 10. September 2004, 23:03 - Rubrik: things i never told you
Das ist in etwa die Essenz von "Der schönste Tag in meinem Leben". Und wenn das doof und uninteressant klingt, dann gegen meinen Willen. Denn vielmehr ist es so: Zauberhaft schwebend klingt das Thema Alter und Jugend, gelebtes, vergeudetes und noch zu erlebendes Leben an und findet einen überzeugenden Kristallisationspunkt: ein Kind mit einer Videokamera. Das klingt wieder blöd. Unschuld, Wahrheit oder nicht, Möglichkeit zu modisch-verwackelten Bildern. Unfähigkeit zur nicht medial vermittelten Weltwahrnehmung könnte auch dahinterstecken, aber nix da. Das Kind filmt seine Familie am Tag seiner Erstkommunion und damit ist dann auch Schluss. Erinnerung ist das Ziel, denn die Familie wird auseinander brechen - nicht völlig, aber doch nicht unbedeutend. Und das wird keine Katastrophe sein, denn es ist das Ergebnis von Einsicht. Erinnerung also, die das Fundament der Zukunft ist, aber nicht als Trauma und Schuldverstrickung, sondern als Akzeptieren der Realität.
Meistens haben Familiendramen zwei mögliche Richtungen. Entweder unter der heilen Oberfläche lauert das Grauen, das dann mehr oder weniger genüsslich ans Tageslicht gezerrt wird oder die Familie ist schon am Anfang am Ende und muss in einem schmerzlichen Prozess lernen, wieder zueinander zu finden. Wie schön mit "Der schönste Tag in meinem Leben" eine Abwechslung zu finden. Selten habe ich einen Familienfilm gesehen, der so gelassen den diversen Dramen seiner Protagonisten folgt, in keine Richtung zu drücken scheint und doch so straff inszeniert ist. Der Film will schon was. Ich glaube, das hier: Wer sich nicht der Liebe hingibt, auch und wesentlich der körperlichen, der macht was falsch. Wer anderen vorschreibt, wie sie zu leben haben, handelt Unrecht und hat meistens allen Grund, sich an die eigene Nase zu fassen. Jede Lebenslüge fliegt irgendwann auf und dann kann es erstmal richtig peinlich werden. So ungefähr. Wie sich das entwickelt, ohne kitschig zu sein, ist bemerkenswert. Und der Film hat eine tolle Sexszene. Sehr körperlich und warm. Mit einer berauschenden Lust an der Berührung.
Meistens haben Familiendramen zwei mögliche Richtungen. Entweder unter der heilen Oberfläche lauert das Grauen, das dann mehr oder weniger genüsslich ans Tageslicht gezerrt wird oder die Familie ist schon am Anfang am Ende und muss in einem schmerzlichen Prozess lernen, wieder zueinander zu finden. Wie schön mit "Der schönste Tag in meinem Leben" eine Abwechslung zu finden. Selten habe ich einen Familienfilm gesehen, der so gelassen den diversen Dramen seiner Protagonisten folgt, in keine Richtung zu drücken scheint und doch so straff inszeniert ist. Der Film will schon was. Ich glaube, das hier: Wer sich nicht der Liebe hingibt, auch und wesentlich der körperlichen, der macht was falsch. Wer anderen vorschreibt, wie sie zu leben haben, handelt Unrecht und hat meistens allen Grund, sich an die eigene Nase zu fassen. Jede Lebenslüge fliegt irgendwann auf und dann kann es erstmal richtig peinlich werden. So ungefähr. Wie sich das entwickelt, ohne kitschig zu sein, ist bemerkenswert. Und der Film hat eine tolle Sexszene. Sehr körperlich und warm. Mit einer berauschenden Lust an der Berührung.
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Spaß. Purer Spaß. Ein Film, von dem man nicht allzuviel erwartet, dem man nicht viel übel nehmen würde, und der doch jede Menge gibt.
Linkalter macht es gut, das war klar, aber er bleibt in der Regie unauffällig.
Es geht um Jack Black und die anderen Kinder, denen er als "Mr. Schneebly" Rock'n'Roll beibringt. Vor allem um Black. Der Film ist kein Starvehikel, denn Black ist kein Star. Er ist ein Blackvehikel.
Kaum eine Einstellung ohne den gesegneten egomanen Clown, und das ist gut so, solange man den Mann mag. Ich mag ihn.
Die Geschichte Kolportage: Ein dicker Looser, dessen Leben Musik ist, schmuggelt sich unter anderem Namen an eine furzkonservative Grundschule und verwandelt seine Klasse in eine begeisterte Rockband, wobei er die bisher unter der Schulpflicht verschütteten Potentiale (Selbstbewusstsein, Kreativität) der Kids zum Leben erweckt.
Die Geschichte ist schlicht, das Drehbuch weiß es und versucht garnicht erst, den Film auf der Spannung der Story aufzubauen - sie begleitet nur das famose Spiel von Black und seinen Schülern, die fast jede Szene zum kleinen Perlchen werden lassen.
Wunderbar: Eine Sequenz, in der Black mit den Kindern, denen er Instrumente zugeteilt hat, Rocker-Posen einübt. Wer dabei an die Mini-Playback-Show denkt ist ein Schuft, denn das hat zuviel Wahrheit: Von der Tradition des Rock, von seiner immer noch aus dem Kanon gedrückten Kultur, von seiner Bedeutung für die Menschen.
Und von dem irren Spaß, der in ihm liegt. Darauf reduziert der Film die Wirkung der Musik, das revolutionäre, antiautoritäre Potenzial wird zwar auch als Unterrichtseinheit vermittelt, aber in der Story nicht wirklich realisiert: Es kommt zum Happy End, die Väter werden nicht umgebracht, sondern begeistert. Aber es ist ja auch ein Kinderfilm.
Linkalter macht es gut, das war klar, aber er bleibt in der Regie unauffällig.
Es geht um Jack Black und die anderen Kinder, denen er als "Mr. Schneebly" Rock'n'Roll beibringt. Vor allem um Black. Der Film ist kein Starvehikel, denn Black ist kein Star. Er ist ein Blackvehikel.
Kaum eine Einstellung ohne den gesegneten egomanen Clown, und das ist gut so, solange man den Mann mag. Ich mag ihn.
Die Geschichte Kolportage: Ein dicker Looser, dessen Leben Musik ist, schmuggelt sich unter anderem Namen an eine furzkonservative Grundschule und verwandelt seine Klasse in eine begeisterte Rockband, wobei er die bisher unter der Schulpflicht verschütteten Potentiale (Selbstbewusstsein, Kreativität) der Kids zum Leben erweckt.
Die Geschichte ist schlicht, das Drehbuch weiß es und versucht garnicht erst, den Film auf der Spannung der Story aufzubauen - sie begleitet nur das famose Spiel von Black und seinen Schülern, die fast jede Szene zum kleinen Perlchen werden lassen.
Wunderbar: Eine Sequenz, in der Black mit den Kindern, denen er Instrumente zugeteilt hat, Rocker-Posen einübt. Wer dabei an die Mini-Playback-Show denkt ist ein Schuft, denn das hat zuviel Wahrheit: Von der Tradition des Rock, von seiner immer noch aus dem Kanon gedrückten Kultur, von seiner Bedeutung für die Menschen.
Und von dem irren Spaß, der in ihm liegt. Darauf reduziert der Film die Wirkung der Musik, das revolutionäre, antiautoritäre Potenzial wird zwar auch als Unterrichtseinheit vermittelt, aber in der Story nicht wirklich realisiert: Es kommt zum Happy End, die Väter werden nicht umgebracht, sondern begeistert. Aber es ist ja auch ein Kinderfilm.
bähr - am Freitag, 10. September 2004, 10:38 - Rubrik: It's only DVD but I like it
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Der Anfang von St. Elmo's Fire ist wirklich eine Gemeinheit. Ist aber auch auf eine perverse, etwas vermoderte Weise verfuehrerisch. Ist es wirklich moeglich, alles Ekelhafte der 80er Jahre in einen Film zu packen. Ein Film, dessen einzige Existenzberechtigung zu sein scheint, Footloose wie ein Meisterwerk aussehen zu lassen. Fast bewundernswert wie Joel Schumacher noch aus jedem Stoff reinstes Gift zu pressen vermag. Ich bin ehrlich gespannt, wie es nach diesen ersten hoellischen Minuten weitergeht.
Svenson - am Mittwoch, 8. September 2004, 22:45 - Rubrik: vorher - nachher
Eben auf DVD gesehen, nachdem ich schon seit Wochen in der DVD-Ausleihe dran vorbeigelaufen bin und mich nicht selten für weit schlechtere Ware entschieden hatte. Auch heute hatte ich schon "Paycheck" in der Hand, weil ich dachte: Ach mach dir nen launigen Abend mit ein Woo-Action-Knaller. Außerdem wollte ich ihm noch ne Chance geben, nachdem ich vor ein paar Tagen von "The Thief" so gelangweilt war, dass ich abgeschaltet habe. Dann nahm ich - das passt - lieber doch "The Good Thief" von Neil Jordan, mit dem ich wechselhafte Erlebnisse verbinde.
Aber mein Gott, das hat mit wirklich gefallen. Nick Nolte, brillant, lässig, schnoddrig, gefährdet, souverän wie immer, in einem traumhaft schimmernden Nizza, umgeben von schönen Halbweltgestalten, dabei, einen großen Casino-Überfall zu planen. Und durchzuführen. Ein wahres caper movie: die Vorgeschichte, die Zusammenstellung des teams, der Verrat, die Dame, der Polizist, die Volten am Ende.
Schöner als Soderberghs Versuch, wenn man mich fragt, gelassener, lässiger, und spannender (wobei der Film allerdings so laid back ist, das Spannung eigentlich nur angespielt, dreimal um den Finger gewirbelt und dann wieder zur Seite gelegt wird).
Die beiden Filme stehen zueinander wie ihre Schauplätze: Las Vegas und Monte Carlo. Und da bin ich natürlich immer für Monte Carlo, aber das ist Geschmackssache.
Und dann noch ein wunderbarer Soundtrack.
Übrigens das Remake eines Melville-Films: Bob le flambeur. Da wären wir wieder bei Melville.
Geht mir weg mit dem Woo.
Aber mein Gott, das hat mit wirklich gefallen. Nick Nolte, brillant, lässig, schnoddrig, gefährdet, souverän wie immer, in einem traumhaft schimmernden Nizza, umgeben von schönen Halbweltgestalten, dabei, einen großen Casino-Überfall zu planen. Und durchzuführen. Ein wahres caper movie: die Vorgeschichte, die Zusammenstellung des teams, der Verrat, die Dame, der Polizist, die Volten am Ende.
Schöner als Soderberghs Versuch, wenn man mich fragt, gelassener, lässiger, und spannender (wobei der Film allerdings so laid back ist, das Spannung eigentlich nur angespielt, dreimal um den Finger gewirbelt und dann wieder zur Seite gelegt wird).
Die beiden Filme stehen zueinander wie ihre Schauplätze: Las Vegas und Monte Carlo. Und da bin ich natürlich immer für Monte Carlo, aber das ist Geschmackssache.
Und dann noch ein wunderbarer Soundtrack.
Übrigens das Remake eines Melville-Films: Bob le flambeur. Da wären wir wieder bei Melville.
Geht mir weg mit dem Woo.
bähr - am Mittwoch, 8. September 2004, 01:34 - Rubrik: It's only DVD but I like it
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen