Ist eigentlich schon wem aufgefallen, dass die Melodie des Werbejingles "Vogelpark Walsrode" genau die Takte aus dem Lied "Alle Vögel sind schon da" sind, auf die "alle Vögel alle" gesungen wird? Finde ich für eine Radioerkennungsmelodie überraschend hintergründig. Aber das nur nebenbei.
bähr - am Dienstag, 28. September 2004, 11:29 - Rubrik: mythen des alltags
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Anlässlich der letzten Folge von "24" begann ich, an „Kill Bill“ zu denken. Und begann, in einer speziellen Szene einen untergründigen Kommentar Tarrantinos zu sehen – nein, nicht auf „24“, das wäre wohl zuviel der Ehre, sondern auf eine bestimmte Haltung im US-Action-Kino und dem flankierenden Serientreiben. Wir erinnern uns: In einem Tokyoter Restaurant zermetztelt Uma Thurman die Entourage von „Cottonmouth“ Lucy Liu. In einem stilisierten Ballet vollzieht sich dieser abstrahierte Kampf, der auf irgendetwas Mimetisches gar nicht mehr hinaus will. Diese uneigentliche Tötungsorgie, deren Opfer maskierte, gleichförmig in Smokings gehüllte, und so komplett entindividualisierte Asiaten sind, steht auch in merkbarem Gegensatz zu den anderen tödlichen Kämpfen des Filmes: Alle anderen Gegner der „Black Mamba“ sind sorgsam charakterisiert, haben ihre eigene Geschichte und Gegenwart, ihren eigenen einmaligen Charakter. Der Filmautor erweist ihnen Respekt. Sie sind alles andere als nett (aber das ist die „Black Mamba“ letztlich auch nicht), und trotzdem wäre es einem eigentlich in jedem Fall lieber, sie würden mit dem Leben davonkommen. Das scheint mir eine grundsätzliche Menschlichkeit, die man Tarantino so erstmal ja gar nicht zutraut, in den Film zu bringen: Wenn hier getötet wird, dann mit der gebührenden Aufmerksamkeit und emotionalen Anspannung für beide beteiligten Seiten. Die Identifizierung wird einem nicht leicht gemacht, etwas weh tut es immer. Der schwarzen Killerin, die nun Mutter ist, hätte man ja ihr neues Leben genauso gegönnt wie Black Mamba das ihre. Das Schwertballett im Restaurant entwirft das Gegenbild: Die große Emotionslosigkeit, die im Sieg des letztlich unangreifbaren Helden über noch so viele stereotype Feinde besteht, und die Masken der japanischen Schwertkiller stehen als Synonym für Klischeefressen wie Nazischergen, russische Geheimdienstler, arabische Terroristen oder eben bosnisch-slavische Menschenschlächter. Womit wir bei „24“ sind, der als Vertreter seiner Art hier in Sippenhaft genommen wird. Die Geschichte basiert wirklich sehr stark auf der Frage nach dem Wert des individuellen Lebens, gerade in der letzten Folge zerbricht ganz offen über dieser Frage die Ehe des Präsidentschaftskandidaten Palmer. Er geht, um die entführte Tochter von Jack Bauer (Kiefer Sutherland) zu schützen, ein großes Risiko für seine Kandidatur ein – seine Frau versucht ihn davon abzubringen und nimmt dabei ganz offen den Tod des Mädchens in Kauf. Es geht also um Moral, und da gibt’s kein Pardon, die Frau hat verloren.
Ein Großteil der Spannung der ganzen Serie speist sich die ganze Zeit aus der Angst der Zuschauer um Personen, die entführt, befreit und wieder entführt oder sonst wie in Lebensgefahr sind, beziehungsweise aus dem Mitleiden mit der Person (Bauer) der durch diese Entführung seiner Familie schier zum Wahnsinn getrieben wird. Er speist sich also aus der großen Identifikation mit diesen „einfachen“ Menschen, die in eine Geheimdienstintrige geraten sind. Die Logik der ganzen Handlung bezieht sich aus dem überragenden Wert der Familie des Jack Bauer für ihn und damit für uns. Gleichzeitig fließt rund um diese Kernfamilie herum das Blut in Strömen, da werden Polizisten, Wachpersonal, Schurkenschergen die Menge abgemurkst, als gäbe es kein Morgen. Mit schönen präzisen Schüssen, Puff, sindse tot, schließlich sind die Täter auf beiden Seiten Profis. Da wird nicht, wie nicht zuletzt bei Tarantino und seien Vätern, langsam schreiend verendet – nein, wie zu John Waynes Zeiten: Ein roter Fleck in Herzgegend, das war’s. Das ist letztlich nicht allzu weit entfernt von der die Treppe hinabrollenden MP in „True Lies“, die zahllose Araber erlegt. Natürlich hier alles mit dem gebührenden Ernst, aber während die Serie eine große moralische und emotionale Anstrengung auf die Leben der Starfamilie legt, sind ihr die vielen Schäden am Rand kein einziges Innehalten wert, keinen Kamerablick zurück. Und wie auch, wenn man so viele Opfer in 24 Stunden (abzüglich Werbepausen) unterbringen muss. Und warum auch: Man kennt die Leute ja kaum. Allein die Besetzung des Hauptmonsters „Drazen“ mit Dennis Hopper zeigt, wie wenig Fantasie man auf die Gestaltung schon der Hauptschurken (Vater: Ex-Offizier, Kriegsverbrecher, Soziopath, Sohn 1: Seelenloser Technokrat: Sohn 2: Europäisch-zynischer Gigolo) verwendet hat. Geschenkt, wird man sagen, war doch ne spannende Sache, ist doch nur ne Serie, und ja: spannend war’s, und nein: Wir haben Hinweise, das GERADE in US-Serien deutlich mehr geht.
Man muss die Leute nicht abknallen, als hätte es „The Wild Bunch“ nie gegeben.
Ein Großteil der Spannung der ganzen Serie speist sich die ganze Zeit aus der Angst der Zuschauer um Personen, die entführt, befreit und wieder entführt oder sonst wie in Lebensgefahr sind, beziehungsweise aus dem Mitleiden mit der Person (Bauer) der durch diese Entführung seiner Familie schier zum Wahnsinn getrieben wird. Er speist sich also aus der großen Identifikation mit diesen „einfachen“ Menschen, die in eine Geheimdienstintrige geraten sind. Die Logik der ganzen Handlung bezieht sich aus dem überragenden Wert der Familie des Jack Bauer für ihn und damit für uns. Gleichzeitig fließt rund um diese Kernfamilie herum das Blut in Strömen, da werden Polizisten, Wachpersonal, Schurkenschergen die Menge abgemurkst, als gäbe es kein Morgen. Mit schönen präzisen Schüssen, Puff, sindse tot, schließlich sind die Täter auf beiden Seiten Profis. Da wird nicht, wie nicht zuletzt bei Tarantino und seien Vätern, langsam schreiend verendet – nein, wie zu John Waynes Zeiten: Ein roter Fleck in Herzgegend, das war’s. Das ist letztlich nicht allzu weit entfernt von der die Treppe hinabrollenden MP in „True Lies“, die zahllose Araber erlegt. Natürlich hier alles mit dem gebührenden Ernst, aber während die Serie eine große moralische und emotionale Anstrengung auf die Leben der Starfamilie legt, sind ihr die vielen Schäden am Rand kein einziges Innehalten wert, keinen Kamerablick zurück. Und wie auch, wenn man so viele Opfer in 24 Stunden (abzüglich Werbepausen) unterbringen muss. Und warum auch: Man kennt die Leute ja kaum. Allein die Besetzung des Hauptmonsters „Drazen“ mit Dennis Hopper zeigt, wie wenig Fantasie man auf die Gestaltung schon der Hauptschurken (Vater: Ex-Offizier, Kriegsverbrecher, Soziopath, Sohn 1: Seelenloser Technokrat: Sohn 2: Europäisch-zynischer Gigolo) verwendet hat. Geschenkt, wird man sagen, war doch ne spannende Sache, ist doch nur ne Serie, und ja: spannend war’s, und nein: Wir haben Hinweise, das GERADE in US-Serien deutlich mehr geht.
Man muss die Leute nicht abknallen, als hätte es „The Wild Bunch“ nie gegeben.
bähr - am Samstag, 25. September 2004, 01:10 - Rubrik: Seasons in the Sun
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Besonders interessant, irgendwie geheimnisvoll sind Männer, die ihre besten Zeiten hinter sich haben. Die, wie Rabbit bei Updike, früher Basketballstar oder wie „der Schwede“ bei Roth Baseballheld waren, die wie Michael Douglas in „Wonderboys“ oder Richard Fords „Sportreporter“ mal einen ersten erfolgreichen Roman geschrieben haben um dann am zweiten zu scheitern oder die wie Cary Grant in „to catch a thief“ oder eben Nick Nolte in „the good thief“, beide ex-Meisterdiebe zu Nizza waren.
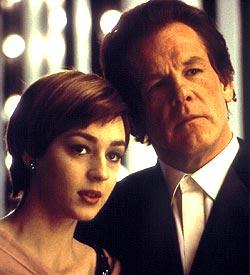
Sie hatten den Erfolg, den man sich wünscht, und stecken trotzdem im Leben, das man kennt, sie haben aber das Glimmen, das Funkeln noch, die Ahnung des Außergewöhnlichen, des Superhelden haftet ihnen noch an, hebt sie, ohne noch realen Grund, aus der Masse, macht sie begehrens- und beobachtenswert, macht jede ihrer Bewegungen interessant, denn die alte Omnipotenz, deren Abglanz Eleganz ist, könnte wieder aufleben, sich entladen. Man lernt sie oft in unguten Situationen kennen, erfährt nur langsam, wer sie mal waren, erwartet daher doch immer noch mehr von ihnen, obwohl zum System gehört, das niemals mehr kommt. Sie sind einen Schritt weiter bei uns und am Tod als der Blinde Samurai, der versoffene Pistolenheld, deren Kräfte nur verborgen, aber präsent sind.

Sie sind sehr europäisch, könnte man meinen. Sie sind zwar Amerikaner, aber sie sind Europäer im Geiste, Auswandererenkel, der Gesellschaft ironisch, bewusst und durch Leid entrückt.Sie haben ihre beste Zeit hinter sich, ihre Vergangenheit erhebt sie, doch gleichzeitig haben sie das Versprechen, das diese Vergangenheit einmal in sich barg, selbst zerstört, haben ihre Möglichkeiten nie ausgespielt, sie billig weggegeben. Und können nun nicht mehr anders, als als distanzierte Randfiguren dazustehen und das Treiben zu beobachten – und vielleicht noch einmal aktiv werden. Doch immer neben der Zeit, nie direkt zum Ziel, immer etwas neben dem Glück. Die schönsten Frauen kriegen sie natürlich trotzdem. Genau, Bill Murray in „Lost in Translation“ ist auch so einer.
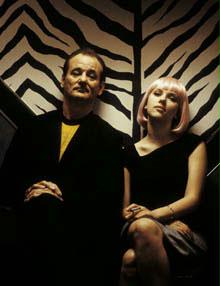
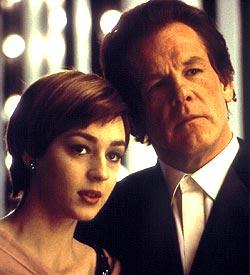
Sie hatten den Erfolg, den man sich wünscht, und stecken trotzdem im Leben, das man kennt, sie haben aber das Glimmen, das Funkeln noch, die Ahnung des Außergewöhnlichen, des Superhelden haftet ihnen noch an, hebt sie, ohne noch realen Grund, aus der Masse, macht sie begehrens- und beobachtenswert, macht jede ihrer Bewegungen interessant, denn die alte Omnipotenz, deren Abglanz Eleganz ist, könnte wieder aufleben, sich entladen. Man lernt sie oft in unguten Situationen kennen, erfährt nur langsam, wer sie mal waren, erwartet daher doch immer noch mehr von ihnen, obwohl zum System gehört, das niemals mehr kommt. Sie sind einen Schritt weiter bei uns und am Tod als der Blinde Samurai, der versoffene Pistolenheld, deren Kräfte nur verborgen, aber präsent sind.

Sie sind sehr europäisch, könnte man meinen. Sie sind zwar Amerikaner, aber sie sind Europäer im Geiste, Auswandererenkel, der Gesellschaft ironisch, bewusst und durch Leid entrückt.Sie haben ihre beste Zeit hinter sich, ihre Vergangenheit erhebt sie, doch gleichzeitig haben sie das Versprechen, das diese Vergangenheit einmal in sich barg, selbst zerstört, haben ihre Möglichkeiten nie ausgespielt, sie billig weggegeben. Und können nun nicht mehr anders, als als distanzierte Randfiguren dazustehen und das Treiben zu beobachten – und vielleicht noch einmal aktiv werden. Doch immer neben der Zeit, nie direkt zum Ziel, immer etwas neben dem Glück. Die schönsten Frauen kriegen sie natürlich trotzdem. Genau, Bill Murray in „Lost in Translation“ ist auch so einer.
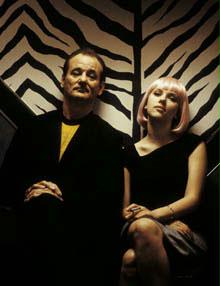
bähr - am Freitag, 24. September 2004, 00:19 - Rubrik: things i never told you
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

(nach Sichtung von "to catch a thief")
bähr - am Donnerstag, 23. September 2004, 22:44 - Rubrik: Der Tod bei der Arbeit
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Am selben Tag "Vater und Sohn" von Sokurov und vier weitere Folgen von "24" (jetzt fehlen noch vier). Wenig überraschend: unterschiedlicher geht's kaum. Sokurov, wie immer, faszinierendes, elegisches, langsames, ästhetisiertes Kunstkino, 24 - packende und im Tempo verdichtete Variation bekannter Themen. Und doch haben sie eine verblüffende Gemeinsamkeit: Bei beiden geht es zentral um einen Soldaten, der auf einen geheimen Kommandoauftrag geschickt wurde, der scheiterte. Der eine - Jack Bauer, wird zeitweilig verdächtigt, deshalb den zukünftigen Präsidenten umbringen zu wollen, der damals den Befehl gab. Von dem anderen - dem namenlosen, verschollenen Freund des Vaters - erzählt man sich genau dasselbe. In zwei Sätzen nur scheint dieses Thema in Sokurovs sonst so verkunstetem, aller Konkretisierung absichtsvoll enthobenem Ballett auf. Ein Einbruch der Realität in die Kunstwelt, die er sorgsam aus St. Petersburg und Lissabon zusammengehäkelt hat. Der ahnen lässt, was eigentlich der Abgrund ist, über dem die Männer den ganzen Film lang so selbstverständlich-erschreckend hinwegtanzen.
In beiden Filmen ist dieses Thema natürlich hochspekulativ, entbehrt aber trotzdem nicht einer gewissen Erdung. Denn es zeigt, dass sowohl die USA von heute als auch das heutige Russland mehr denn je tief vom Millitarismus geprägte Gesellschaften sind, in denen diese Stories, die uns im braven Deutschland ähnlich kolportiert wie Science-Fiction-Szenarien erscheinen, tatsächlich möglich sind. Staaten, die sich im Krieg befinden, und das mit Unterbrechungen seit Jahren. Eine andere Parallele untermauert das: Der Sohn, Alexej, ist auf der Millitärakademie - "warum?" wird er gefragt. "Familientradition" ist seine Antwort. Eine Antwort, die an die Mutter aus Fahrenheit 9/11 erinnert, die von ebendieser Tradition in ihrer Familie erzählt, und dass die Fortführung der Tradition die einzige Chance der Kinder auf einen Weg aus dem Elend ist.
In den USA und in Russland kann es den Kids, die im Kino sind, tatsächlich passieren, dass sie eines Tages auf Einsätze geschickt werden, von denen sie vielleicht nicht zurückkehren oder deren psychologische Folgen sie so verändern, wie sie es mit Jack Bauer oder dem Freund des Vaters gemacht haben - beide kehrten so verändert zurück, dass sie ihre Frauen verließen. Sie werden wohl nicht den Präsidenten umbringen - aber vielleicht drüber nachdenken.
Sie werden sich nicht die Filme Sokurovs ansehen - es gibt genug russische Kriegsstreifen, die den Krieg in Afganistan aufarbeiten oder ausbeuten.
Wir kriegen - leider - wenig aus Russland, aber viel aus Amerika. Wir importieren via Kino und TV einen Großteil unserer Werte aus einem Land im Kriegszustand, dessen Menschen mit ganz anderen Realitäten umgehen müssen als wir.
Das sollte man immer wieder bedenken, wenn man sich mit den Streifen beschäftigt: Hier wird Realität verarbeitet, das ist kein Fantasy-Genre. Realität nicht weniger Menschen (wie im Agentenfilm), sondern ganzer Bevölkerungschichten, die sich mit dem, was sie in gerecht genannten Kriegen erlebt haben - oder noch erleben werden, Bush und Putin sorgen schon dafür - auseinandersetzen müssen. Die dafür einen Anker brauchen. Und diesen Anker brauchen wir nicht. Unsere Filme handeln von Zivis, der Soldat kommt selten vor.
Unsere Filme können nicht über verschüttete Traumata aus Kriegen erzählen, ein gesellschaftliches Thema, das offenbar erzählerisch so produktiv ist. Uns bleibt die Beziehungskomödie, und wir sollten froh darüber sein. Oder unserer Generation bleibt, wie es Freund Lutz in einem gewissen Film sagte, die gemeinsame Erfahrung des Booms und des Downturns, von der wir einst unseren Kindern erzählen können wie unsere Väter vom Krieg.
Das ist belangloser, unmännlicher, von geringerer Tragik, da sind Existenzen gescheitert, aber naja. Keine Stahlgewitter.
Für's Leben sehr gut. Für die Filmkunst vielleicht nicht.
In beiden Filmen ist dieses Thema natürlich hochspekulativ, entbehrt aber trotzdem nicht einer gewissen Erdung. Denn es zeigt, dass sowohl die USA von heute als auch das heutige Russland mehr denn je tief vom Millitarismus geprägte Gesellschaften sind, in denen diese Stories, die uns im braven Deutschland ähnlich kolportiert wie Science-Fiction-Szenarien erscheinen, tatsächlich möglich sind. Staaten, die sich im Krieg befinden, und das mit Unterbrechungen seit Jahren. Eine andere Parallele untermauert das: Der Sohn, Alexej, ist auf der Millitärakademie - "warum?" wird er gefragt. "Familientradition" ist seine Antwort. Eine Antwort, die an die Mutter aus Fahrenheit 9/11 erinnert, die von ebendieser Tradition in ihrer Familie erzählt, und dass die Fortführung der Tradition die einzige Chance der Kinder auf einen Weg aus dem Elend ist.
In den USA und in Russland kann es den Kids, die im Kino sind, tatsächlich passieren, dass sie eines Tages auf Einsätze geschickt werden, von denen sie vielleicht nicht zurückkehren oder deren psychologische Folgen sie so verändern, wie sie es mit Jack Bauer oder dem Freund des Vaters gemacht haben - beide kehrten so verändert zurück, dass sie ihre Frauen verließen. Sie werden wohl nicht den Präsidenten umbringen - aber vielleicht drüber nachdenken.
Sie werden sich nicht die Filme Sokurovs ansehen - es gibt genug russische Kriegsstreifen, die den Krieg in Afganistan aufarbeiten oder ausbeuten.
Wir kriegen - leider - wenig aus Russland, aber viel aus Amerika. Wir importieren via Kino und TV einen Großteil unserer Werte aus einem Land im Kriegszustand, dessen Menschen mit ganz anderen Realitäten umgehen müssen als wir.
Das sollte man immer wieder bedenken, wenn man sich mit den Streifen beschäftigt: Hier wird Realität verarbeitet, das ist kein Fantasy-Genre. Realität nicht weniger Menschen (wie im Agentenfilm), sondern ganzer Bevölkerungschichten, die sich mit dem, was sie in gerecht genannten Kriegen erlebt haben - oder noch erleben werden, Bush und Putin sorgen schon dafür - auseinandersetzen müssen. Die dafür einen Anker brauchen. Und diesen Anker brauchen wir nicht. Unsere Filme handeln von Zivis, der Soldat kommt selten vor.
Unsere Filme können nicht über verschüttete Traumata aus Kriegen erzählen, ein gesellschaftliches Thema, das offenbar erzählerisch so produktiv ist. Uns bleibt die Beziehungskomödie, und wir sollten froh darüber sein. Oder unserer Generation bleibt, wie es Freund Lutz in einem gewissen Film sagte, die gemeinsame Erfahrung des Booms und des Downturns, von der wir einst unseren Kindern erzählen können wie unsere Väter vom Krieg.
Das ist belangloser, unmännlicher, von geringerer Tragik, da sind Existenzen gescheitert, aber naja. Keine Stahlgewitter.
Für's Leben sehr gut. Für die Filmkunst vielleicht nicht.
bähr - am Donnerstag, 23. September 2004, 01:38 - Rubrik: Ein andalusischer Film
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Heute die Folgen 5-8.
Doch, das fängt an Spaß zu machen. Ich bin nicht wirklich erschlagen von der Sache, aber doch doch...
Man muss der ganzen Sache beinahe schon zugute halten, dass sie sich, abgesehen von dem 24 h-Gimmick, ohne den es letztlich auch gegangen wäre, nicht bemüht, wie eine der neuen Erfolgsserien (HBO et.al.) rüberzukommen - niemand fängt an zu singen, geht zum Psychiater, lässt andere mit Blicken zu Staub verbrennen oder hat ulkige Neurosen. Das ist natürlich alles nicht übel und häufig brillant, aber "MONK" zeigt bei aller Unterhaltsamkeit auch, wie diese Ideen zur Attitüde werden können, die über Konventionalität hinwegtäuscht. Hier also nur der 24 h - Tickticktick, und der ist nett. Ansonsten ist es erfreulich solide gemacht - und die Geschichte ist tatsächlich so schön druchgebastelt, dass auch das schon wieder nett zu beobachten ist, ohne dass der Spin zu weit gedreht wird.
Was ich mich Frage: wenn Jamie, die Computermieze, der Maulwurf ist, warum hat sie nicht die Keycard, die kurz davor stand, geknackt zu werden, ausgewechselt, warum ging der Erpresser das Risiko ein, Bauer zurück in seine Zentrale zu schicken...will mir nicht so recht einleuchten. Klärt sich ja möglicherweise noch auf, aber ich glaube nicht so recht daran...
Abwarten.
Kiefer macht seine Sache gut. Xander Berkley, den ich hier Putinesk finde ebenfalls, wird aber nachdem klar ist, dass weder er noch der immer verdächtig rüberguckende Exlover Tony die Verräter sind, wenig gezeigt. Klar - für's Erste klar? Die ganzen Geschehnisse umd die entführte Tochter sind insgesamt überflüssig, aber mit irgendwas muss man die Zeit ja voll kriegen. Wie ja auch die Abende auf der Couch.
Doch, das fängt an Spaß zu machen. Ich bin nicht wirklich erschlagen von der Sache, aber doch doch...
Man muss der ganzen Sache beinahe schon zugute halten, dass sie sich, abgesehen von dem 24 h-Gimmick, ohne den es letztlich auch gegangen wäre, nicht bemüht, wie eine der neuen Erfolgsserien (HBO et.al.) rüberzukommen - niemand fängt an zu singen, geht zum Psychiater, lässt andere mit Blicken zu Staub verbrennen oder hat ulkige Neurosen. Das ist natürlich alles nicht übel und häufig brillant, aber "MONK" zeigt bei aller Unterhaltsamkeit auch, wie diese Ideen zur Attitüde werden können, die über Konventionalität hinwegtäuscht. Hier also nur der 24 h - Tickticktick, und der ist nett. Ansonsten ist es erfreulich solide gemacht - und die Geschichte ist tatsächlich so schön druchgebastelt, dass auch das schon wieder nett zu beobachten ist, ohne dass der Spin zu weit gedreht wird.
Was ich mich Frage: wenn Jamie, die Computermieze, der Maulwurf ist, warum hat sie nicht die Keycard, die kurz davor stand, geknackt zu werden, ausgewechselt, warum ging der Erpresser das Risiko ein, Bauer zurück in seine Zentrale zu schicken...will mir nicht so recht einleuchten. Klärt sich ja möglicherweise noch auf, aber ich glaube nicht so recht daran...
Abwarten.
Kiefer macht seine Sache gut. Xander Berkley, den ich hier Putinesk finde ebenfalls, wird aber nachdem klar ist, dass weder er noch der immer verdächtig rüberguckende Exlover Tony die Verräter sind, wenig gezeigt. Klar - für's Erste klar? Die ganzen Geschehnisse umd die entführte Tochter sind insgesamt überflüssig, aber mit irgendwas muss man die Zeit ja voll kriegen. Wie ja auch die Abende auf der Couch.
bähr - am Freitag, 17. September 2004, 00:52 - Rubrik: Seasons in the Sun